Eine digitale Signatur bestätigt, dass der Unterzeichner einen Dokumentenstand eindeutig "unterschrieben“ hat.

Zusammenfassung: Digitale Unterschriften sind bei standortübergreifendem Arbeiten und Remote Work besonders wichtig geworden. Sie sind rechtsgültig, wenn das passende Sicherheitslevel beachtet wird. Während einfache digitale Unterschriften für formfreie Verträge ausreichen, erfordern Verträge ohne Formfreiheit eine qualifizierte elektronische Signatur für rechtliche Sicherheit. In Deutschland reguliert die eIDAS-Verordnung die verschiedenen Formen der digitalen Signatur: einfach, fortgeschritten und qualifiziert. Alle drei haben unterschiedliche Sicherheitsstufen. Digitale Unterschriften sind damit ebenso rechtsgültig wie handschriftliche, es sei denn, sie sind explizit ausgeschlossen.
Statt wie früher Dokumente aufwändig ausdrucken und einzeln unterschreiben zu lassen, durchlaufen sie nun ihren Unterschriften-Lifecycle per Knopfdruck. Doch so praktisch dieses Vorgehen auch sein mag, die wesentliche Frage lautet: Sind digitale Unterschriften rechtsgültig zum Beispiel für einen Vertrag? Vorab sei gesagt, ja, das sind sie. Jedenfalls dann, wenn Sie auf das richtige Sicherheitslevel setzen. Die wichtigsten Fakten, die Sie zur digitalen Signatur wissen sollten, haben wir Ihnen zusammengefasst.
Es gibt folgende Varianten der digitalen Unterschrift: einfache, fortgeschrittene und qualifizierte elektronische Signatur, je mit einem eigenen Sicherheitslevel.
ohne Anforderungen, zum Beispiel eine gescannte Unterschrift oder E-Mail-Signatur
setzt eine elektronische Verschlüsselung sowie ein digitales Zertifikat voraus
benötigt ebenso eine elektronische Verschlüsselung sowie ein digitales Zertifikat, ist jedoch an deutlich striktere Anforderungen gekoppelt.
Bei der eIDAS-Verordnung handelt es sich um die EU-Verordnung Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1993/93/EG. Sie regelt in Deutschland bzw. in der gesamten EU, dass qualifizierte elektronische Signaturen rechtsgültig sind und manuelle Signaturen ersetzen. Auf dieser Grundlage werden elektronische Unterschriften seit Juli 2016 europaweit anerkannt und eingesetzt.
Haben Sie Ihre Signatur auch als Scan auf dem Computer gespeichert und fügen sie bei Bedarf direkt in ein Dokument ein? Auf diese Möglichkeit greifen viele zurück, schließlich ist sie unkompliziert und ein Dokument mit wenigen Klicks signiert. Doch Achtung: Eine manuelle Unterschrift, die verscannt und in ein Dokument eingefügt wird, schafft keine Rechtssicherheit für Dokumente ohne Formfreiheit. Eine solche elektronische Unterschrift ist weder auf dem Computer noch auf dem Tablet gültig. Es handelt sich lediglich um eine einfache elektronische Signatur.
Außerdem gibt es ein zweites Szenario, in dem eine elektronische Signatur nicht rechtsgültig ist: wenn der Gesetzgeber die elektronische Signatur für ein zu unterzeichnendes Dokument explizit ausschließt. In diesem Falle ist auch eine qualifizierte elektronische Signatur nicht ausreichend. Die Unterschrift muss verpflichtend manuell erfolgen, um den Status der Rechtsgültigkeit zu erreichen.
Nun stellt sich die Frage, bei welchen Dokumentformen eine elektronische Unterschrift möglich ist und welche Version dafür benötig wird. Die gute Nachricht: In den meisten Fällen ist eine einfache bzw. fortgeschrittene elektronische Signatur ausreichend, da für diese Dokumente Formfreiheit gilt.
Einige Beispiele sind:
Manche Dokumente sind jedoch nur dann rechtskräftig, wenn sie mit qualifizierter elektronischer Signatur unterschrieben sind.
Typischerweise handelt es sich dabei um:
Sie wollen auf Nummer sicher gehen? In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, trotz Rechtsgültigkeit auf eine manuelle Unterschrift zu setzen – ein Jurist ist hierfür ihr bester Ansprechpartner.
Kurz zur Erinnerung: Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass Verträge digital unterschrieben werden dürfen, wenn der Gesetzgeber die elektronische Form nicht explizit ausschließt. Das gilt insbesondere für qualifizierte elektronische Signaturen. Besondere Aufmerksamkeit ist zum Beispiel bei Kündigungen geboten. Denn diese sind nur dann tatsächlich rechtskräftig, wenn sie händisch und persönlich unterschrieben wurden. Eine qualifizierte elektronische Signatur ist nicht ausreichend.
Weitere Beispiele hierfür sind:
Was für die EU die eIDAS-Verordnung ist, ist in der Schweiz das Bundesgesetz über die elektronische Signatur (ZertES). Es regelt, welche Anforderungen für elektronische Signaturen gelten. Achtung ist Geboten, wenn schweizer Unternehmen mit Firmen in der Europäischen Union handeln, denn dann gelten zusätzlich die eIDAS-Vorgaben.
Die wesentlichen Vorgaben der ZertES sind:
Digitale Signaturen sind eine große Erleichterung, um in der hybriden Arbeitswelt unkompliziert Unterschriften einzuholen. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn je nach Dokumentart können sich die Anforderungen an die Sicherheitsstufe deutlich unterscheiden. In einigen Ausnahmen ist sogar nur eine handschriftliche Unterschrift tatsächlich rechtsgültig. Wichtig für Unternehmen: Um auf Nummer sicher zu gehen, nehmen Sie Ihren Anwalt mit ins Boot. Denn mit juristischer Beratung sind Sie auch bei Ausnahmen auf der sicheren Seite, was die Wahl der passenden Signatur betrifft.
Haftungsausschluss: Der Artikel umfasst Informationen zu rechtlichen Rahmenbedingungen. Er ist jedoch keine Rechtsberatung, zudem kann sich die Gesetzgebung jederzeit verändern. Die Verwendung von digitalen Signaturen hängt weiterhin von internen und Formvorgaben ab und kann von den aufgeführten Beispielen abweichen. Unsere Empfehlung: Stimmen Sie Ihre Anwendungsfälle und Szenarien mit einer Rechtsberatung ab.
 Alles über digitale Unterschriften – Beitrag öffnen
Alles über digitale Unterschriften – Beitrag öffnen
Eine digitale Signatur bestätigt, dass der Unterzeichner einen Dokumentenstand eindeutig "unterschrieben“ hat.
 Zufriedene Mitarbeiter dank New Work und DMS – Beitrag öffnen
Zufriedene Mitarbeiter dank New Work und DMS – Beitrag öffnen
Paulus Celik erklärt, wie digitales Dokumentenmanagement zufriedene Mitarbeiter schafft und voran bringt.
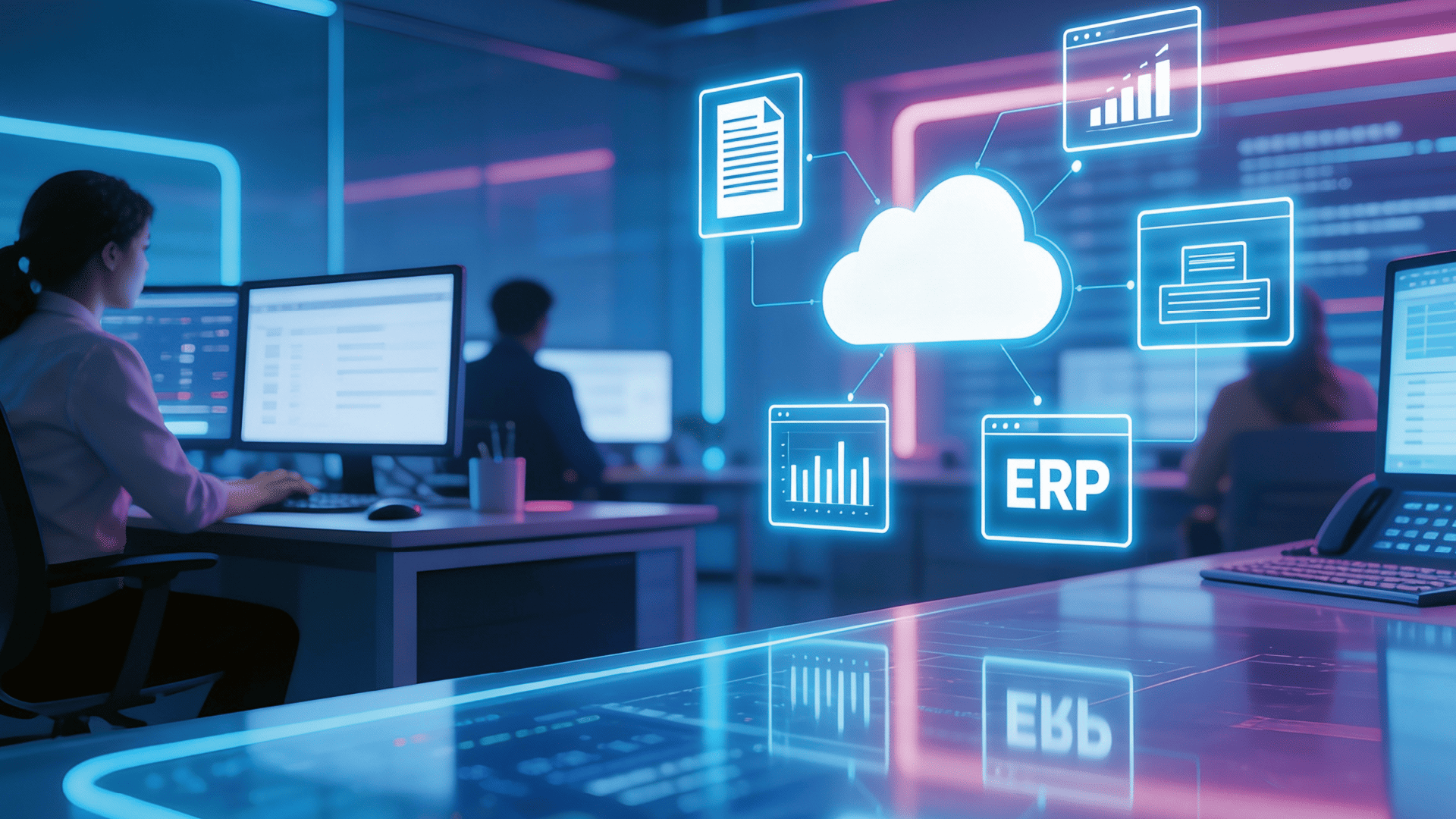 DMS Integration in ERP, CRM und Co. – Beitrag öffnen
DMS Integration in ERP, CRM und Co. – Beitrag öffnen
Die DMS Integration wird für moderne Unternehmen immer relevanter. Wie geht man dabei vor?